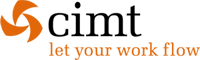In der GEMA haben sich Komponisten, Textdichter und Musikverleger als Urheber von Musikwerken zusammengeschlossen. Die GEMA nimmt die Rechte der Musikschaffenden in Deutschland und von weltweit über zwei Millionen weiteren Rechteinhabern wahr. Sie sorgt dafür, dass die Urheber und Musikverleger an den Einnahmen aus der Nutzung ihrer Musikwerke angemessen beteiligt sind.
In einer Welt, in der datenbasierte Entscheidungen zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden, ist ein effizienter und skalierbarer Datenverarbeitungsprozess unerlässlich. Doch in vielen Unternehmen sind gewachsene Strukturen, manuelle Prüfprozesse und unflexible Workflows bis heute Realität.
Das Projekt mit der GEMA verdeutlicht, wie der gezielte Einsatz von Databricks im Rahmen einer Lakehouse-Architektur ein zuvor fragmentiertes Setup aus SQL, Excel und manuellen Abstimmungsprozessen in eine moderne Datenplattform mit hohem Automatisierungsgrad verwandelt hat. Dadurch erhalten zahlreiche Fachbereiche ihre Daten mit hoher Zuverlässigkeit, Qualität und Aktualität – bei gleichzeitig reduzierten Kosten und höherer Transparenz.